Einleitung
Die Hantzsch-Widman-Patterson-Nomenklatur ist eines von zwei
Systemen zur Benennung von
Heterocyclen,
wenn sich kein Trivialname für die zu benennende Struktur etabliert hat.
Nach dem Hantzsch-Widman-Patterson-System werden drei- bis zehngliedrige
Heterocyclen benannt.
Allgemeiner Aufbau
Der Name eines Heterocyclus baut sich bei Verwendung der
Hantzsch-Widman-Patterson-Nomenklatur aus dem
a-Term-Präfix – für das Heteroatom –
und einem Suffix zusammen, der die Ringgröße und den
Sättigungsgrad beschreibt. Wenn der Suffix mit einem Vokal
beginnt, entfällt das namensgebende a des a-Term-Präfices.
Präfices
Jedes Element besitzt seinen eigenen Präfix.
Sind in einem Heterocyclus mehrere verschiedene Heteroatome
enthalten, erfolgt eine Priorisierung der Präfices entsprechend
der Stellung im Periodensystem.
Die a-Term-Präficies und die Reihenfolge der wichtiger Elemente
sind in der untenstehenden Tabelle angegeben.
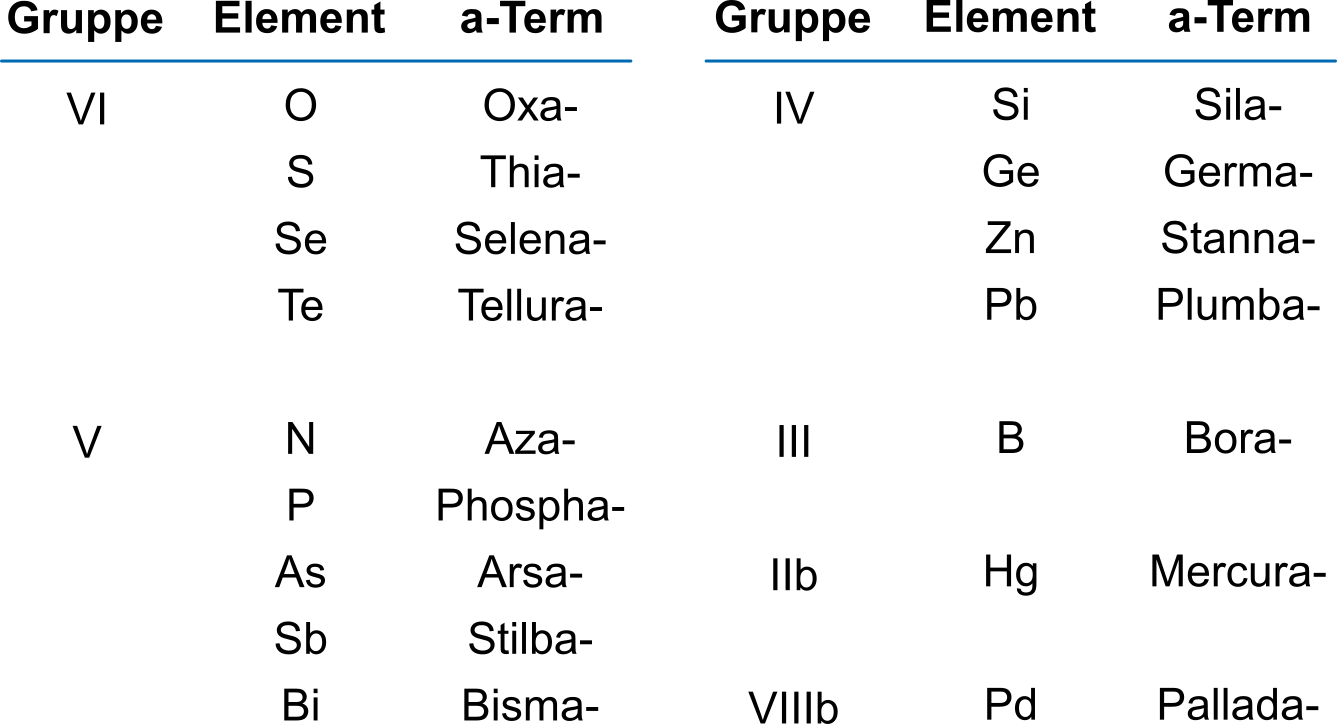
Eine vollständige Liste aller Präfices inklusive der
Prioritäten können über den untenstehenden Button im
scheLM PSE erreicht werden.
Suffices
Die Nachsilbe wird nach folgenden Kriterien ausgewählt:
Ringgröße und Sättigungsgrad. Außerdem gibt es besondere
Regelungen für die Benennung kleiner N-haltiger Heterocyclen
sowie sechsgliedriger Heterocyclen. Partiell ungesättigte
Ringsysteme werden wie vollständig ungesättigte Heterocyclen
benannt und erhalten bspw. die Vorsilbe Dihydro-.
Die nachfolgende Tabelle fasst die Suffices zusammen.
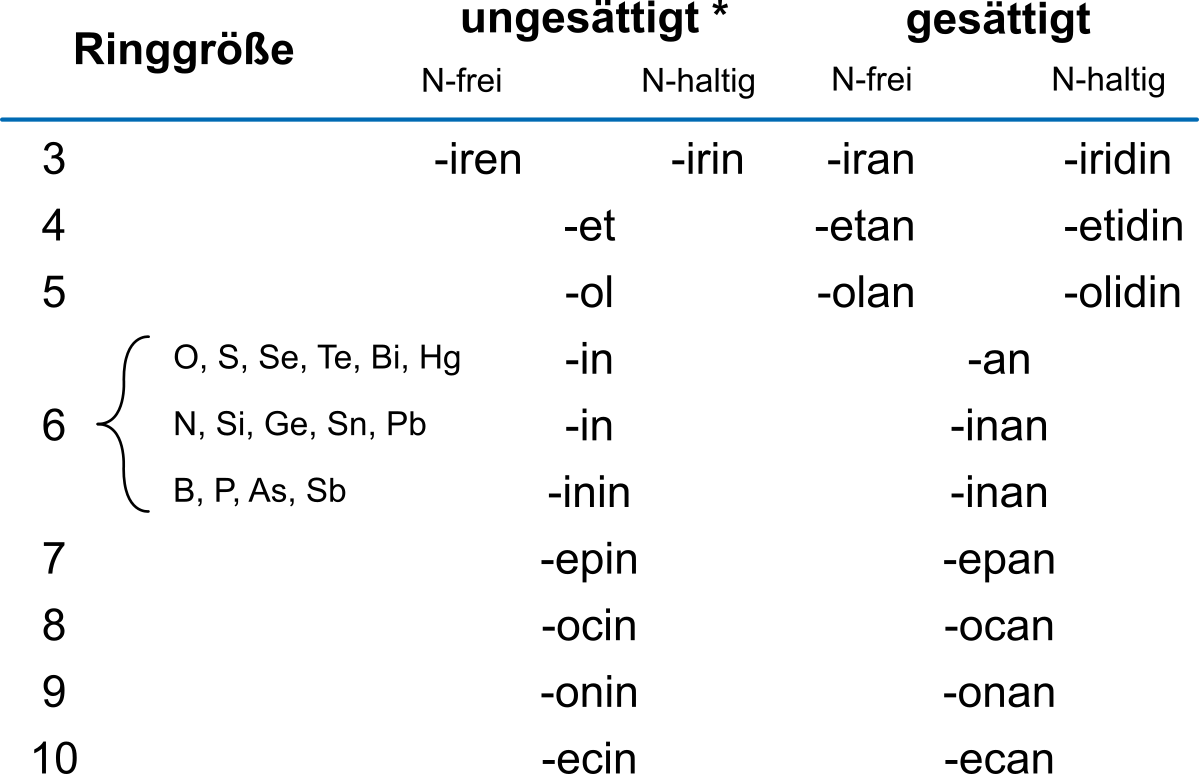
* als „ungesättigt“ bezeichnet man ein System, in dem
es maximal so viele Doppelbindungen gibt, dass keine
kumulierten
Doppelbindungen enstehen
Beispiele
Die folgenden Beispiele sollen die Bennenung von Heterocyclen mithilfe der
Hantzsch-Widman-Patterson verdeutlichen.
 Es handelt sich um einen ungesättigten Dreiring mit einem Sauerstoffatom:
Oxiren. Oxiren ist formal antiaromatisch und besitzt eine hohe
Baeyer-Ringspannung.
Daher sind Oxirene bei Raumtemperatur nicht stabil.
Es handelt sich um einen ungesättigten Dreiring mit einem Sauerstoffatom:
Oxiren. Oxiren ist formal antiaromatisch und besitzt eine hohe
Baeyer-Ringspannung.
Daher sind Oxirene bei Raumtemperatur nicht stabil.
 Ein gesättigter Dreiring mit einem Stickstoffatom ist als Aziridin bekannt.
Ein gesättigter Dreiring mit einem Stickstoffatom ist als Aziridin bekannt.
 Nebenstehend ist ein N-haltiger ungesättigter Dreiring mit einem Stickstoffatom
dargestellt: Azirin. Das abgebildete 1H-Azirin ist instabil und isomerisiert
umgehend zum 2H-Azirin, welches immernoch äußerst reaktiv ist.
Nebenstehend ist ein N-haltiger ungesättigter Dreiring mit einem Stickstoffatom
dargestellt: Azirin. Das abgebildete 1H-Azirin ist instabil und isomerisiert
umgehend zum 2H-Azirin, welches immernoch äußerst reaktiv ist.
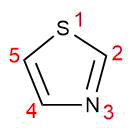 Der fünfgliedrige Heterocyclus mit der maximalen Anzahl an nicht-kummulierten
Doppelbindungen besitzt ein Schwefel- und ein Stickstoffatom. Er kann systematisch
als 1,3-Thiazol bezeichnet werden; als Trivialname hat sich nur
Thiazol
etabliert.
Der fünfgliedrige Heterocyclus mit der maximalen Anzahl an nicht-kummulierten
Doppelbindungen besitzt ein Schwefel- und ein Stickstoffatom. Er kann systematisch
als 1,3-Thiazol bezeichnet werden; als Trivialname hat sich nur
Thiazol
etabliert.
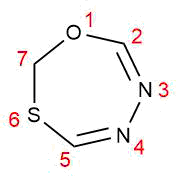 Der nebenstehende Heterocyclus besitzt sowohl zwei Stickstoffatome sowie ein Sauerstoff-
und ein Schwefelatom; geordnet nach ihrer Priorität (O > S > N) ergibt sich als Präfix:
„Oxathiadiaza-“. Es handelt sich weiter um einen partiell ungesättigten
siebengliedrigen Ring, sodass als Suffix „-epin“ gewählt wird.
Werden die ringbildenden Atome nun so durchnummeriert, dass mit dem Atom höchster
Priorität begonnen wird und alle weiteren Heteroatome möglichst kleine Nummern
erhalten, ergibt sich der vollständige Name zu
„7H-1,6,3,4-Oxathiadiazepin“.
Der nebenstehende Heterocyclus besitzt sowohl zwei Stickstoffatome sowie ein Sauerstoff-
und ein Schwefelatom; geordnet nach ihrer Priorität (O > S > N) ergibt sich als Präfix:
„Oxathiadiaza-“. Es handelt sich weiter um einen partiell ungesättigten
siebengliedrigen Ring, sodass als Suffix „-epin“ gewählt wird.
Werden die ringbildenden Atome nun so durchnummeriert, dass mit dem Atom höchster
Priorität begonnen wird und alle weiteren Heteroatome möglichst kleine Nummern
erhalten, ergibt sich der vollständige Name zu
„7H-1,6,3,4-Oxathiadiazepin“.
Anellierte Systeme
Der Name von anellierten Systemen setzt sich aus den Bezeichnungen
der einzelnen Heterocyclen sowie deren Verknüpfung zusammen.

Er wird von hinten nach vorne
konstruiert.
-
Ermittlung der Stammkomponente (und infolgedessen der
anillierten Komponente)
Zur Festlegung des Stammkörpers werden folgende
Regeln nacheinander abgearbeitet. Die erste Regel, die eine
Unterscheidung zulässt, definiert den Stamm.
-
der Heterocyclus ist der Stamm;
-
der stickstoffhaltige Heterocyclus ist Stamm;
-
der Heterocyclus mit dem Heteroatom höchster Priorität
(siehe Tabelle mit den a-Term-Präficies)
ist der Stamm;
-
die Komponente, die die größte Azahl Ringe
enthält, ist der Stamm;
-
die Komponente, die den größten
individuellen Heterocyclusenthält,
ist der Stamm;
-
die Komponente mit der größten Anzahl
an beliebigen Heteroatomen ist der Stamm;
-
die Komponente mit der größten Vielfalt
an Heteroatomen ist der Stamm;
-
die Komponente mit der größten Anzahl an
Heteroatomen, die die höchste Priorität
haben, ist der Stamm;
-
wenn es die Wahl gibt, zwischen zwei Komponenten mit
der gleichen Ringgröße und der gleichen Anzahl und
Art der Heteroatome, dann wähle die Komponente als
Basis, bei denen die Heteroatome vor der Fusion die
niedrigsten Nummern getragen haben.
-
Festlegung der Verknüfung in eckigen Klammern
-
Bezifferung der Bindungen im Stamm mit Kleinbuchstaben
entsprechend der Atomnummerierung
-
Ermittlung der anellierten Bindung
-
Ermittlung der Atomnummern der anellierten Komponente,
mit denen sie an den Stamm knüpft
-
Ermittlung der Kranzbezifferung
-
Polyheterocyclisches System so ausrichten, dass
die größte Ringanzahl in der Horizontalen liegt und
die maximale Ringanzahl nach rechts oben weist.
-
Nummerierung im Uhrzeigersinn beginnend oben rechts
mit dem linkesten Atom, welches nicht Teil zweier
Ringe ist.
-
Ermittlung des Sättigunsgrades
-
Bestimmung des Hydrierungsgrades und der Position
der Hydrierungen anhand der Kranzbezifferung.
Das Modul
scheLM s2n
widmet sich ausführlich der Nomenklatur anellierter Heterocyclen.
Beispiele
Die beiden folgenden einfachen Beispiele sollen zum Verständnis der
Nomenklatur anellierter Systeme mittels der Hantzsch-Widman-Patterson-Nomenklatur
beitragen.
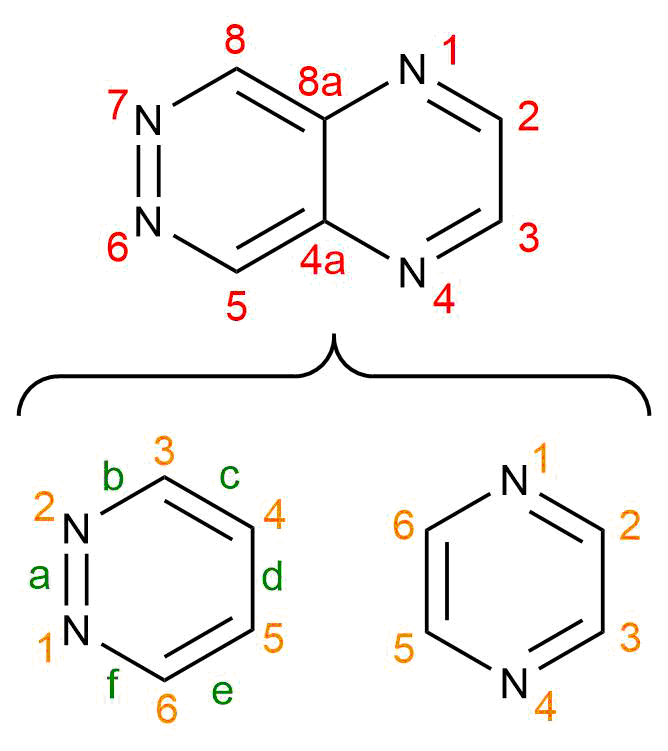 Das nebenstehende bicyclische System lässt sich von Pyrazin und Pyridazin ableiten.
Das nebenstehende bicyclische System lässt sich von Pyrazin und Pyridazin ableiten.
Die Ermittlung des Stamms erfolgt nach Kriterium i, da alle vorangegangene
Kriterien sowohl auf Pyrazin als auch auf Pyridazin zutreffen: in Pyridazin
tragen die Heteroatome vor der Fusion die niedrigsten Nummern.
Der Stamm ist mit Bindung d an die Atome 2 und 3 des Pyrazins anelliert.
Der gezeigte Heterocyclus wird als „Pyrazino[2,3-d]pyridazin“
bezeichnet.
 Das nebenstehende Fusionsprodukt von 1,3-Dioxol und Imidazol ist ein bicyclischer
Heterocyclus.
Das nebenstehende Fusionsprodukt von 1,3-Dioxol und Imidazol ist ein bicyclischer
Heterocyclus.
Der Stamm ergibt sich nach Kriterium b, da nur einer der beiden Heterocyclen N-haltig
ist: Imidazol.
Imidazol ist mit Bindung d an die Atome 4 und 5 von 1,3-Dioxol anelliert.
Zur Ermittlung der Kranzbezifferung wird das Molekül horizontal ausgerichtet;
es kann sowohl ein Stickstoff- als auch ein Sauerstoffatom oben rechts zum
Liegen kommt. Da die Priorität von Sauerstoff größer als jene von Stickstoff ist,
bekommt Sauerstoff die niedrigere Ziffer zugeteilt.
Das dargestellte Molekül ist an Position 4 gesättigt.
Als Name ergibt sich folglich „4H-1,3-Dioxolo[4,5-d]imidazol“.
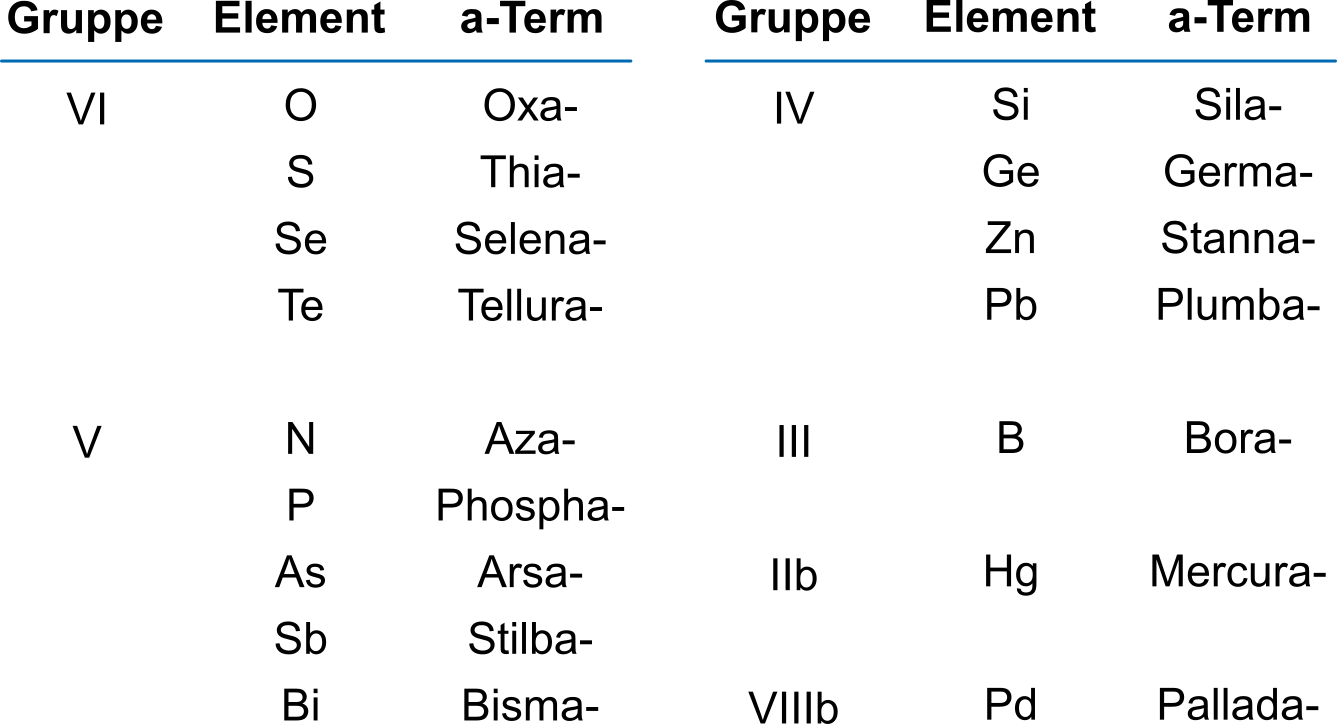
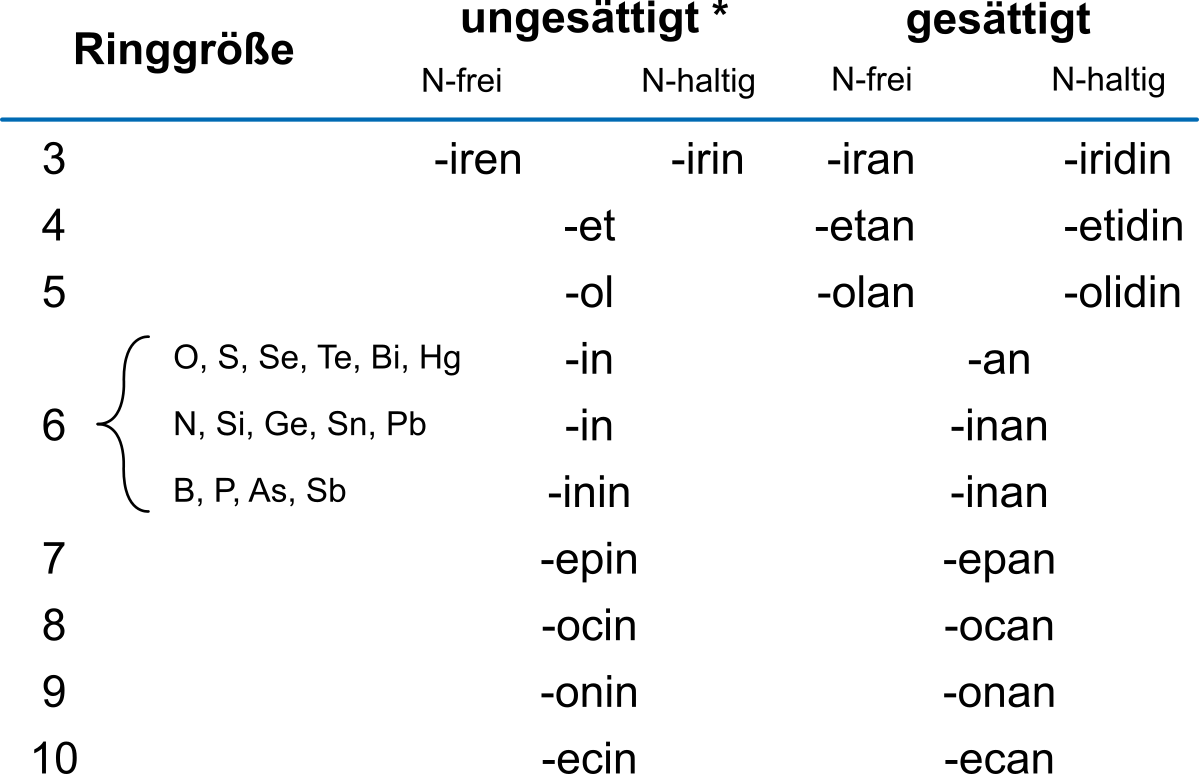
 Es handelt sich um einen ungesättigten Dreiring mit einem Sauerstoffatom:
Oxiren. Oxiren ist formal antiaromatisch und besitzt eine hohe
Es handelt sich um einen ungesättigten Dreiring mit einem Sauerstoffatom:
Oxiren. Oxiren ist formal antiaromatisch und besitzt eine hohe
 Ein gesättigter Dreiring mit einem Stickstoffatom ist als Aziridin bekannt.
Ein gesättigter Dreiring mit einem Stickstoffatom ist als Aziridin bekannt.  Nebenstehend ist ein N-haltiger ungesättigter Dreiring mit einem Stickstoffatom
dargestellt: Azirin. Das abgebildete 1H-Azirin ist instabil und isomerisiert
umgehend zum 2H-Azirin, welches immernoch äußerst reaktiv ist.
Nebenstehend ist ein N-haltiger ungesättigter Dreiring mit einem Stickstoffatom
dargestellt: Azirin. Das abgebildete 1H-Azirin ist instabil und isomerisiert
umgehend zum 2H-Azirin, welches immernoch äußerst reaktiv ist.
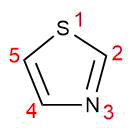 Der fünfgliedrige Heterocyclus mit der maximalen Anzahl an nicht-kummulierten
Doppelbindungen besitzt ein Schwefel- und ein Stickstoffatom. Er kann systematisch
als 1,3-Thiazol bezeichnet werden; als Trivialname hat sich nur
Der fünfgliedrige Heterocyclus mit der maximalen Anzahl an nicht-kummulierten
Doppelbindungen besitzt ein Schwefel- und ein Stickstoffatom. Er kann systematisch
als 1,3-Thiazol bezeichnet werden; als Trivialname hat sich nur
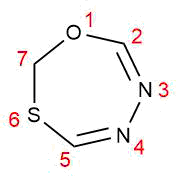 Der nebenstehende Heterocyclus besitzt sowohl zwei Stickstoffatome sowie ein Sauerstoff-
und ein Schwefelatom; geordnet nach ihrer Priorität (O > S > N) ergibt sich als Präfix:
„Oxathiadiaza-“. Es handelt sich weiter um einen partiell ungesättigten
siebengliedrigen Ring, sodass als Suffix „-epin“ gewählt wird.
Werden die ringbildenden Atome nun so durchnummeriert, dass mit dem Atom höchster
Priorität begonnen wird und alle weiteren Heteroatome möglichst kleine Nummern
erhalten, ergibt sich der vollständige Name zu
„7H-1,6,3,4-Oxathiadiazepin“.
Der nebenstehende Heterocyclus besitzt sowohl zwei Stickstoffatome sowie ein Sauerstoff-
und ein Schwefelatom; geordnet nach ihrer Priorität (O > S > N) ergibt sich als Präfix:
„Oxathiadiaza-“. Es handelt sich weiter um einen partiell ungesättigten
siebengliedrigen Ring, sodass als Suffix „-epin“ gewählt wird.
Werden die ringbildenden Atome nun so durchnummeriert, dass mit dem Atom höchster
Priorität begonnen wird und alle weiteren Heteroatome möglichst kleine Nummern
erhalten, ergibt sich der vollständige Name zu
„7H-1,6,3,4-Oxathiadiazepin“.

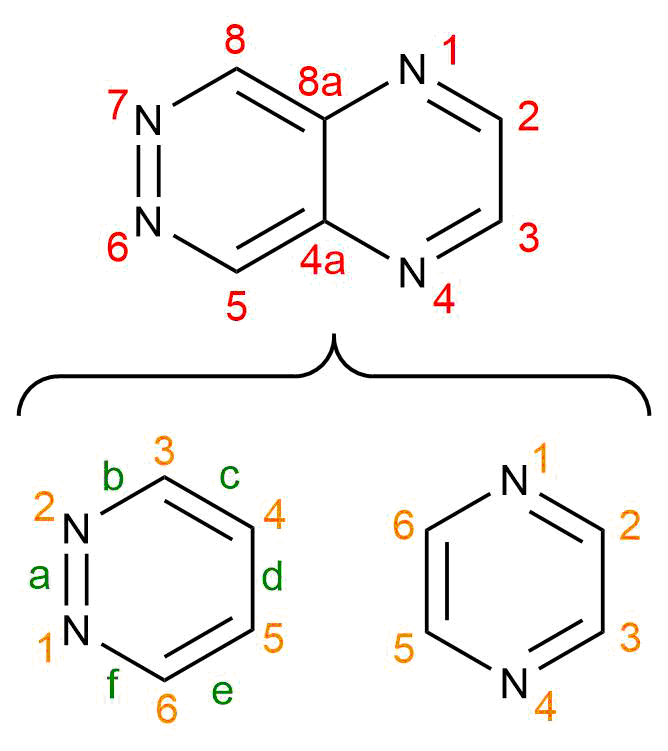 Das nebenstehende bicyclische System lässt sich von Pyrazin und Pyridazin ableiten.
Das nebenstehende bicyclische System lässt sich von Pyrazin und Pyridazin ableiten. Das nebenstehende Fusionsprodukt von 1,3-Dioxol und Imidazol ist ein bicyclischer
Heterocyclus.
Das nebenstehende Fusionsprodukt von 1,3-Dioxol und Imidazol ist ein bicyclischer
Heterocyclus.